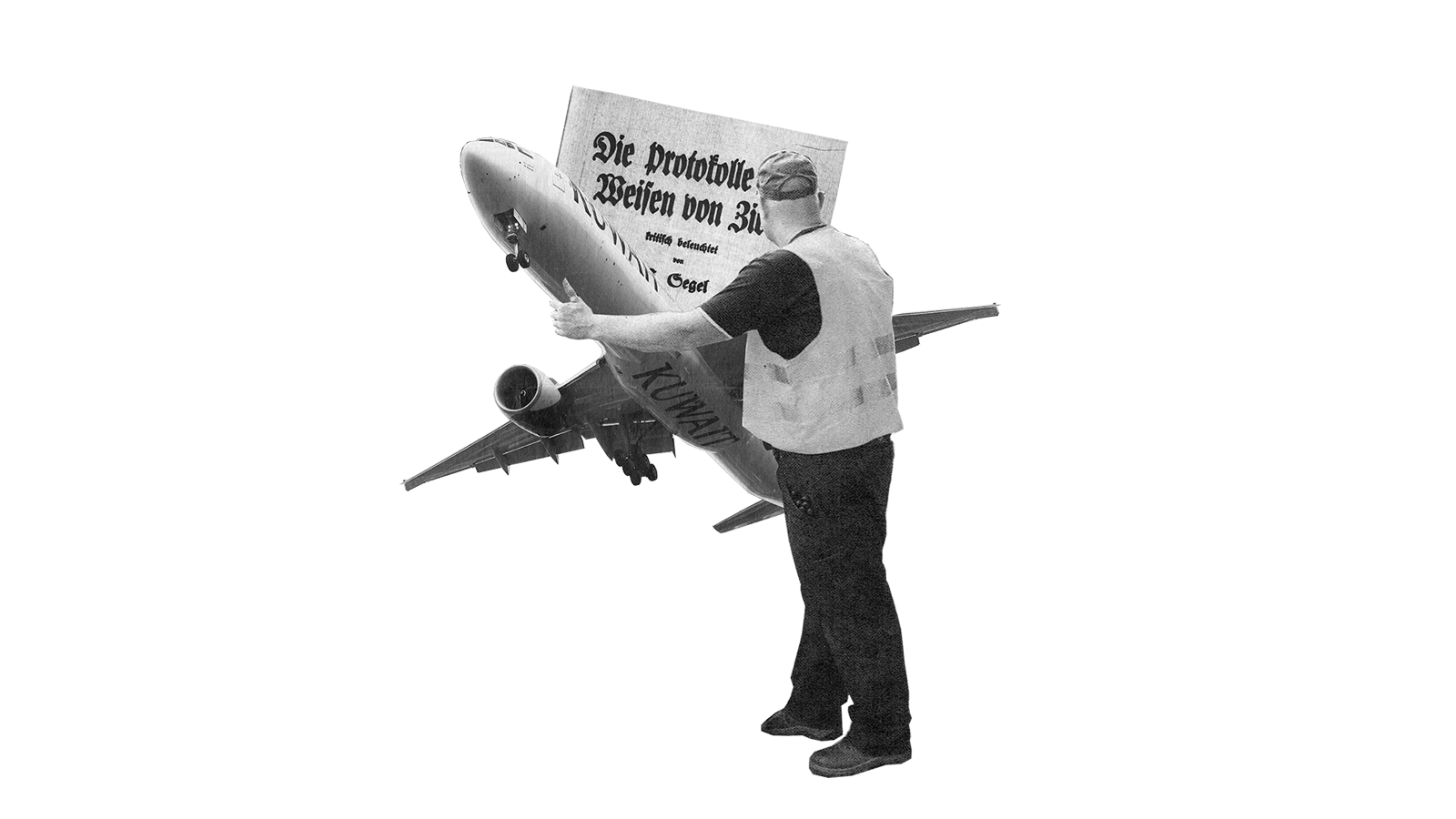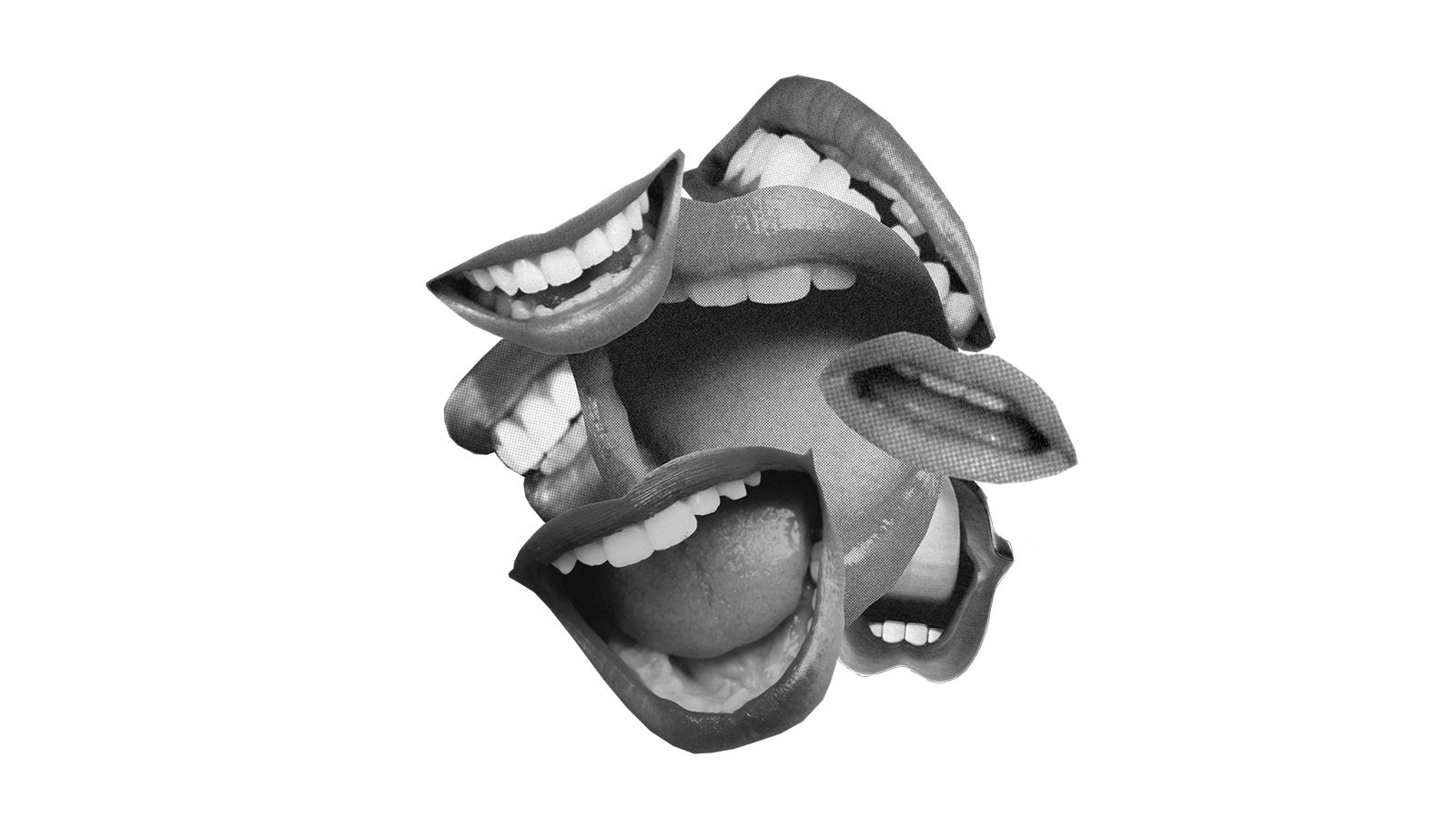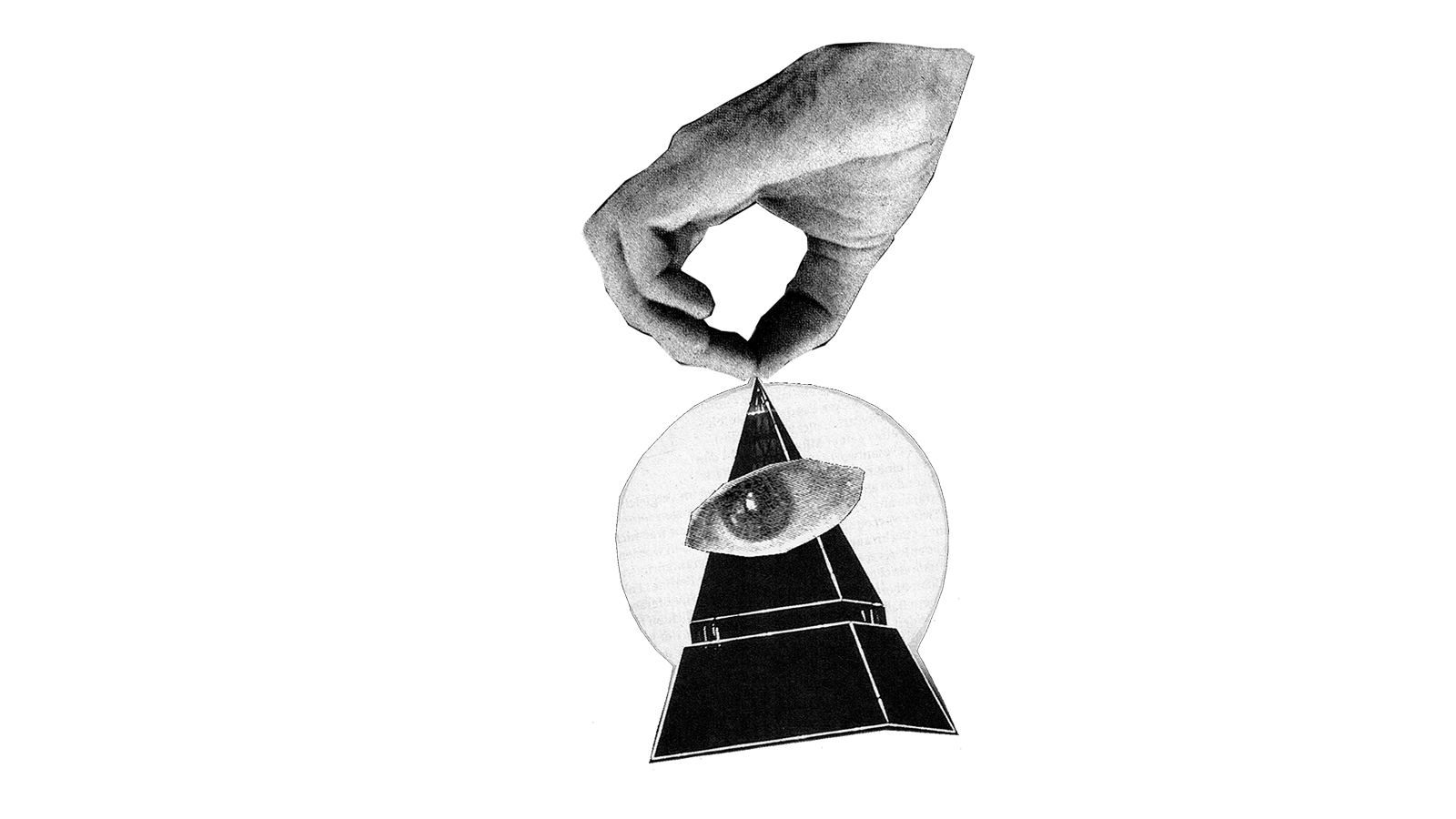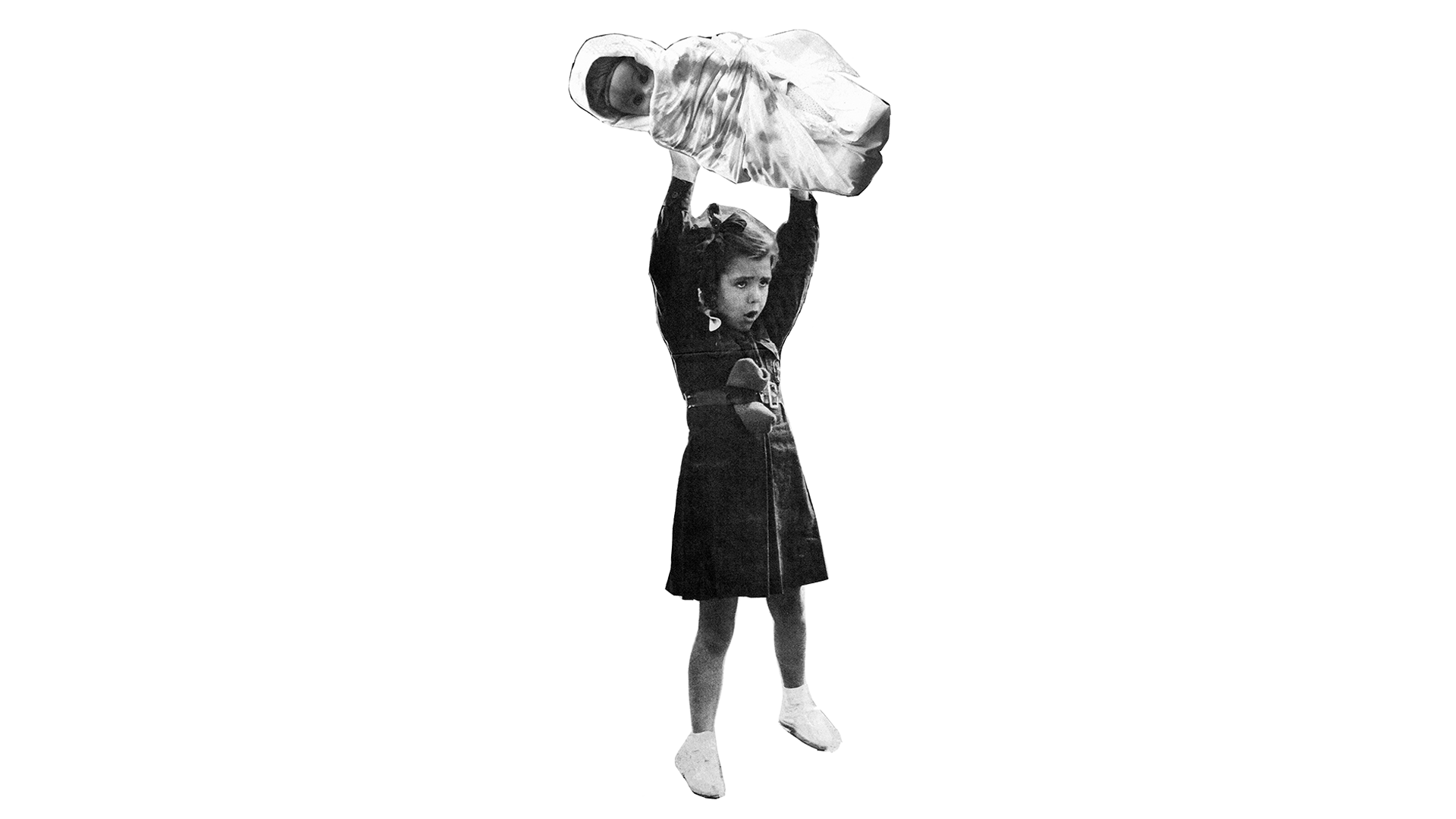»Einige meiner besten Freunde sind Juden!«
Die Unterscheidung zwischen »guten« Jüdinnen*Juden, mit denen man sich gern abgibt, und »schlechten« Jüdinnen*Juden, deren Befinden als weniger wichtig eingestuft wird, ist ein typisch antisemitisches Verhalten. Immer wieder versuchen Menschen, ihre judenfeindlichen Ressentiments so zu verteidigen. Damit bestätigen sie jedoch, dass es durchaus Jüdinnen*Juden gibt, gegen die sie etwas haben – andernfalls müssten sie ihre Freundschaft nicht so übermäßig betonen, sondern könnten Debatten mit rationalen Argumenten austragen. Dass es beim Kampf gegen Antisemitismus um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Jüdinnen*Juden geht – nicht nur einer Teilgruppe – wird hier ausgeblendet.
Persönliche Nähe oder Distanz zu Jüdinnen*Juden sagt wenig darüber aus, ob Äußerungen und Einstellungsmuster antisemitisch sind oder nicht. Antisemitismus ist eine bestimmte Sicht auf die Welt, die versucht, deren reale oder angenommenen Ungerechtigkeiten, Widersprüche und Konflikte mit einem simplen Erklärungsmuster aufzulösen, an dessen Ende immer das abstrakte Jüdische steht. In seiner gewaltvollen, physischen Form richtet sich Antisemitismus zwar gegen ganz reale Jüdinnen*Juden, als Ideologie funktioniert er allerdings überindividuell. Konkret bedeutet dies, dass die Freundschaft zu jüdischen Menschen nichts damit zu tun hat, ob jemand an antisemitische Verschwörungsideologien glaubt, Israel dem Erdboden gleichmachen will, oder anderen judenfeindlichen Narrativen auf den Leim geht.
Die Soziologin Julia Bernstein weist in der Studie »Mach mal keine Judenaktion!« darauf hin, dass der Verweis auf jüdische Freund*innen zum Teil auch das Resultat der fortschreitenden Ächtung offen antisemitischer Aussagen sei und es sich um eine Abwehrstrategie handle. Antisemitismus, der als solcher erkannt werden könne, bedürfe demnach einer Entschuldigung oder Rechtfertigung. Dies führe regelmäßig dazu, dass entsprechende Statements mit einer ungefragten Distanzierung von jeglichem Antisemitismus oder eben einem positiven Bezug zu Jüdinnen*Juden eingeleitet werden. Dies stellt den Versuch dar, das eigentlich sozial Unsagbare doch noch sagbar zu machen. Letztlich handelt es sich um eine durchschaubare Kommunikationsstrategie: Der Verweis auf meist ohnehin nicht nachprüfbares Privates schafft eine moralische Erhabenheit über den Gesprächsgegenstand und soll jegliche Kritik erschweren, da diese nun keine rein sachliche mehr ist, sondern plötzlich sehr persönlich wird 1.
Bernstein, J. (2018): »Mach mal keine Judenaktion«: Herausforderungen und Lösungsansätze in der professionellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus. Frankfurt am Main
↩